Es tut sich etwas: Demonstrierende, Forschende, Expertinnen und Experten, Ermittelnde, Kritikerinnen und Kritiker…
Die 13-Uhr-Nachrichten auf Deutschlandfunk Nova waren inklusiv und korrekt und ich hatte nichts zu meckern…. .-) Bravo!
Es tut sich etwas: Demonstrierende, Forschende, Expertinnen und Experten, Ermittelnde, Kritikerinnen und Kritiker…
Die 13-Uhr-Nachrichten auf Deutschlandfunk Nova waren inklusiv und korrekt und ich hatte nichts zu meckern…. .-) Bravo!
Schon etwas länger online:
Gemacht vom Journalistinnenbund e.V.
Ein spannender Artikel auf t3n über die Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts, den wir durch unsere Sprache produzieren und der sich in den Suchergebnissen bei Google widerspiegelt:
Der Artikel hat mich sogar zu einem frühmorgendlichen Kommentar hingerissen:
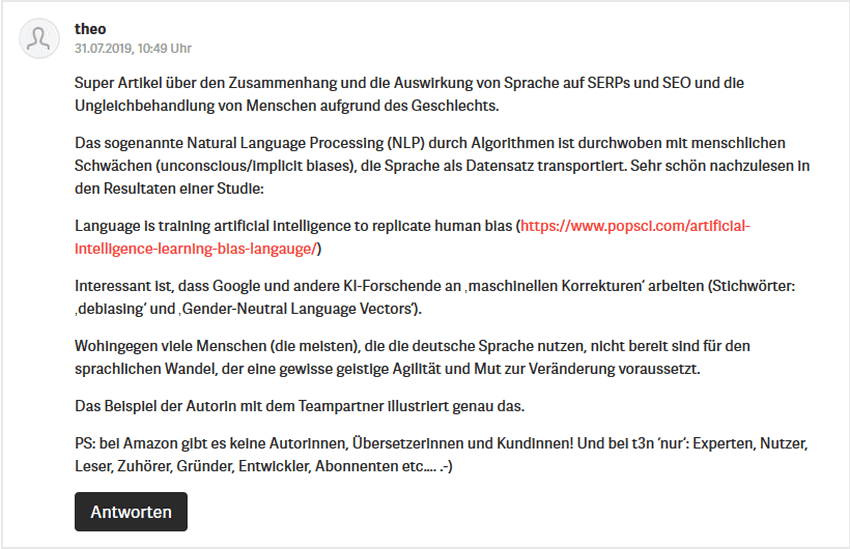
Ein Lesetipp zum Thema diversitätssensible Sprache:
Im abschließenden Absatz:
«Innovative sprachliche Handlungen könnten hier ein wichtiger Baustein sein. Das Schöne ist, dass jede Person dies in jedem Moment machen kann. Wir müssen nicht auf neue Gesetze, Regeln, Normen warten – sprachlich respektvoll zu handeln und neue Ausdrucksweisen auszuprobieren, sind Möglichkeiten, die wir alle kontinuierlich haben, wollen wir an einer diskriminierungsfreieren Gesellschaft mitarbeiten. Sprache bietet uns eine Chance dazu, in jedem Moment.» (zeit.de)
Ein Link- und Lesetipp vom 01.01.2019:
Christoph Bräuer – Professor für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur an der Göttinger Universität – im Interview mit dem Göttinger Tageblatt: Continue reading «Wir, unsere Werte und unsere Sprache»
Hörtipp.
Nicht ganz meine Position, aber auf jeden Fall interessant:
Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat sich letzten Freitag (gestern) getroffen und entschieden, das Gendern weiter zu beobachten und vorerst keine Empfehlungen in Bezug auf das Binnen-I, den Gender-Gap, das Gender-Sternchen und der deutschen Rechtschreibung auszusprechen.
Viele Artikel kommentieren heute diese Entscheidung.
Zwei Beiträge gehören zu meinem Best-Of in der Debatte.
Erstens: das unaufgeregte Interview von Deutschlandfunk Kultur mit Henning Lobin, Mitglied des Rats und Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim, das auch Geschäftsstelle des Rats für deutsche Rechtschreibung ist:
In dem Interview sind mir zwei Aussagen aufgefallen:
» …wo werden z.B. keine geschlechtergerechten Formulierungen benutzt, das ist z.B beim Journalismus….» (Henning Lobin)
Und diese letztere Aussage leitet direkt über zu zweitens. Einen Kommentar von Pascal Becher, der meine Einstellung und die meines eBooks widerspiegelt:
Jetzt kann „man“ sagen: „Ist halt so.“ Die „anderen“ sind ja irgendwie auch „mitgemeint“. So argumentieren beispielsweise wir Medien gerne, um umständliche Wortkonstruktionen wie „Lehrer*in“, „Lehrer_in“ oder „Lehr_er_in“ zu vermeiden. Was wir uns dann aber auch eingestehen müssen, ist, dass wir ausgrenzend und unpräzise formulieren…» (Pascal Becher, pfaelzischer-merkur.de)
Das ist genau meine Position. Das Gendern ist eine Strategie, um das generische Maskulinum und damit das Mitmeinen von Frauen zu vermeiden. Denn das generische Maskulinum ist nicht inklusiv (es ist ausgrenzend) und nicht korrekt (es ist unpräzise). Sprachliche Gleichbehandlung und das generische Maskulinum sind einfach nicht kompatibel.
Dass das im Jahr 2018 bei vielen Medienmachenden immer noch nicht angekommen ist…
Auch der weitere Kommentar spricht mir aus dem Herzen:
«„Umständlich“ ist zudem ein schwaches Argument, um Ungerechtigkeit zu rechtfertigen. Und „elitär“ ist an Debatten über unsere Sprache sowieso nichts. Es ist die Basis unseres Zusammenlebens. Außerdem müssen ja Sternchen, Binnen-I und Unterstrich nicht das letzte Wort sein. Richtende, Laufende oder Trinkende geht ja auch.» (Pascal Becher, pfaelzischer-merkur.de)
Bravo! Denn bei der Gender-Rechtschreibung-Debatte vergessen viele Personen, dass sehr oft geschlechtsneutrale Formulierungen möglich sind. Z.B: Lehrende, Chirurgie-Team, Wissenschafts-Team, Forschende, Arbeitnehmende, Fachleute…
So wie ich sie auch ein meinem eBook vertrete, ist: das generische Maskulinum ist nicht mehr zeitgemäß und nicht geeignet für eine inklusive und korrekte Sprache.
Es ist nicht inklusiv, weil es ausgrenzt. Es ist unkorrekt, weil es komplexe Wahrnehmungen und Realitäten nicht adäquat repräsentiert.
Darüber hinaus deutet die Forschung im Bereich der kognitiven Linguistik und der Neurolinguistik darauf hin, dass Sprache und damit das generische Maskulinum unser Denken strukturiert und beeinflusst.
Wir müssen weg vom generischen Maskulinum. Manchmal halt mit zusätzlichen Hilfsmitteln wie den Unterstrichen (Gaps), den Sternchen, den Binnen-Is oder der doppelten Nennung.
Aber: geschlechtsneutrale Formulierungen, wann immer möglich, sind die beste Lösung.
Vor einiger Zeit war ich auf einer Veranstaltung zum Thema Super-Diversity (Superdiversität) und Migration.
Via Google lande ich beim Thema Superdiversität im Online-Universum der Max-Planck-Gesellschaft:
«Der Kulturanthropologe Steven Vertovec beschreibt diese Komplexitätssteigerung sich überschneidender Formen von Unterschiedlichkeit als Superdiversität (super-diversity). Superdiversität in Vertovecs Sinne verweist auf eine komplexe mehrdimensionale Diversifizierung bereits existierender Formen sozialer und kultureller Vielfalt.» (‚Diversität und Gesellschaft‘, Fußnoten entfernt (mpg.de))
Sehr verkürzt ist Superdiversität die Diversifikation der Diversität:
«It has also been called the «diversification of diversity» (en.wikipedia.org)
Eine kulturelle Praktik, in der ‚Formen sozialer und kultureller Vielfalt‘, aber auch Alter- und Gender-Unterschiede produziert und reproduziert werden ist: unsere Sprache.
Welche Auswirkungen hat die Diversifikation der Diversität für das Projekt einer inklusiven Sprache?
Inklusive Sprache, so wie ich sie in meinem eBook skizziere, ist diversitäts- und auch super-diversitäts-sensibel 🙂
Das Konzept der Superdiversität unterstreicht jedoch die Wichtigkeit zweier Punkte für eine inklusive Sprache:
Denn das generische Maskulinum ist nicht diversitäts-sensibel, weil es die Anforderung an eine sprachliche Gleichbehandlung nicht erfüllt. Frauen mitzumeinen ist nicht diversitäts-sensibel, sondern exkludierend, benachteiligend.
Wenn das generische Maskulinum schon bei dem Anspruch an sprachlicher Gleichbehandlung von zwei geschlechtlichen Identitäten versagt, dann kapituliert es komplett bei super-diversen Anforderungen; wie z.B. die sprachliche Inklusion von super-diversen sexuellen Identitäten.
Deshalb sind geschlechtsneutrale Formulierungen, immer wenn möglich, die Super-Lösung!
Für eine inklusive Sprache, in der sich auch super-diverse Menschen wohlfühlen, gilt das gleiche, wie für eine inklusive Sprache und eine ’normale‘ Diversität, nämlich:
Ich markiere keine Differenz, keine (Super-) Diversität, kein Anderssein durch Sprache.
Es sei denn: ich habe einen ’sachlichen Grund‘ (siehe das AGG § 20) oder es besteht ein ‚begründetes öffentliches Interesse‘ (siehe den Deutscher Pressekodex Ziffer 12).
Die Frage ist also zuerst: wieso will ich überhaupt (Super-) Diversität sprachlich abbilden?
Beispiel: jung=technik-affin und älter=nicht technik-affin?
Superdiversität ist keine Herausforderung für eine inklusive Sprache. Ganz im Gegenteil; ich denke, nur mit und in einer inklusiven Sprache ist Superdiversität möglich.
Das Konzept der Superdiversität verweist jedoch stark auf:
«…den relativen Bedeutungsverlust von Kollektivität [z.B. Nationalität, Geschlecht, Alter, Ethnizität] als Beschreibungskategorie in komplexen Gesellschaften.» (‚Diversität und Gesellschaft‘ (mpg.de) [ich])
Mein Google-Alert hat mich recht spät erreicht.
In den scilogs auf spektrum.de gab es von Martin Ballaschk folgenden Artikel am 18. Oktober:
Mit vielen Kommentierenden…
Ein schöner Erfahrungsbericht des Autors aus der Welt eines Wissens-Kommunikators.
Im Artikel ist auch folgendes Video zum Thema mit der Wissens-Kommunikatorin Mai Thi Nguyen-Kim (maiLab):
In einem vorherigen Post hatte ich folgenden Beispielsatz:
„Den Gedanken, dass Programmierer sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst werden müssen, finde ich extrem bedeutsam.“
Als HTML-Code könnte das generische Maskulinum so aussehen:
<p>„Den Gedanken, dass <weiblich-mitgemeint>Programmierer</weiblich-mitgemeint> sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst werden müssen, finde ich extrem bedeutsam.“</p>
Oder lieber direkt als CSS-Klasse auslagern?
<p class=»mitgemeint»>„Den Gedanken, dass Programmierer sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst werden müssen, finde ich extrem bedeutsam.“</p>
p.mitgemeint {
text-intention: bei generischem Maskulinum sind weibliche Menschen mitgemeint}
Nachdem ich den Post über meine Lieblings-Zitate aus dem Buch Political Framing gemacht hatte, guckte ich beim Twitter von Elisabeth Wehling vorbei. Dort habe ich das #GrammaticalFraming zusammen mit dem #GenerischesMaskulinum gefunden.
Eine sehr gute Vernetzung!
Das generische Maskulinum ist eine Form des Framings. Durch die permante Wiederholung von Wörtern im grammatikalischen generischen Maskulinum brennen sich die Wörter neuronal in die Gedanken von Menschen ein. Und dort sind die Wörter Wissen, das auch Handeln prägt…
…auch die Szene der Gründenden?
«Nach wie vor sind Frauen als Gründer deutlich in der Unterzahl. 85 Prozent der Gründer sind Männer. In den vergangenen Jahren hat sich dieser Wert kaum verbessert. Beim ersten Bericht im Jahr 2013 waren 87 Prozent der Gründer männlich.» (handelsblatt.de)
Aus:
Gründerinnen gibt es nicht!? Sprachliche Inklusion und Gleichbehandlung hört sich andern an, Repräsentation mit Wörtern geht korrekter:
Nach wie vor sind Frauen als Gründende deutlich in der Unterzahl. 85 Prozent der Gründenden sind Männer. In den vergangenen Jahren hat sich dieser Wert kaum verbessert. Beim ersten Bericht im Jahr 2013 waren 87 Prozent der Gründenden männlich.
Zum Suchwort ‚weiblicher Gründer‘ (google.de) lieferte mir Google gerade «Ungefähr 2.500 Ergebnisse (0,30 Sekunden)»!
Der Süddeutschen Zeitung lag ein buntes Beiblatt bei: eine Anzeigensonderveröffentlichung von Google. Der Titel: Aufbruch – Künstliche Intelligenz – Was sie bedeutet und wie sie unser Leben verändert (06.10.18).
Zu den Fragen «Wie machen wir KI gerecht?» und «Können Algorithmen Vorurteile haben?» (S. 30) antwortet Fernanda Viégas, Leiterin der Goolge-Initiative PAIR (People+ AI Research):
«Digitale Voreingenommenheit entsteht üblicherweise durch Tendenzen im Datensatz, mit dem das Machine-Learning-System trainiert wird. Gibt es eine Unausgewogenheit in den Daten, wird sie sich auch in den Ergebnissen des Systems zeigen. Wenn etwa ein Datensatz mit Aussprachebeispielen auf männlichen Rednern basiert, wird ein Spracherkennungssystem, das auf diesen Daten basiert, sehr wahrscheinlich bei Männern besser funktionieren als bei Frauen. Ein solches System bezeichnen wir als voreingenommen zugunsten von Männern.»
Das hört sich gut an. Wir müssen uns mal wieder mit unserer Sprache auseinandersetzen. Diesmal in der Form von Datensätzen in menschlicher Sprache.
Wenn ich dann jedoch auf Seite 34 der Werbung für KIs von Google lese:
«Den Gedanken, dass Programmierer sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst werden müssen, finde ich extrem bedeutsam.» (Peter Dabrock)
dann wird mir angst und bange. Nicht nur wegen der fehlenden Ethik-Kompetenz aufseiten der Programmierenden, sondern wegen des generischen Maskulinums des Ethik-Professors.
Wie ethisch sind Visionen formuliert im generischen Maskulinum? Welche ethische Kompetenz kommuniziert der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats damit? Wie ethisch ist seine Ethik?